|
Wie
es damals war...die stürmische Zeit des ESQ1
 |
|
Ensoniq
ESQ 1
|
Wir befinden und in der Mitte der
achten Dekade des vorigen Jahrhundert. Ganz Synthesizerland
ist von den Japanern besetzt! Ganz Synthesizerland? Nein!
Ein kleines Team von unbeugsamen ehemaligen Commodore Entwicklern
in Malvern/ USA beginnt, sich mit ihrem Zaubertrank erfolgreich
gegen das übermächtige Imperium aufzulehnen. So
oder so ähnlich könnte man die Situation des Synthesizermarktes
Mitte der 80er beschreiben. ;-) Ganz so krass war es nicht,
Oberheims und andere waren auch noch da. Dennoch war es die
Zeit der neuen Ideen und Computerentwickler. Sie sollten zunehmend
eine wichtigere Rolle am Instrumentenmarkt spielen.
Technologische Entwicklungen finden
ständig statt. Am intensivsten erlebt man verfahrenstechnische
Veränderungen jedoch in jener Zeit, in der man sich damit
zu beschäftigen beginnt. So ist es kein Zufall, dass
ich die stärksten Erneuerungen und emotionalen Bindungen
zu Beginn meines Musiklebens Mitte der 80er verspürte.
Genau in dieser Zeit, so um 1984/ 85, fokussierte ich meine
Aufmerksamkeit auf neue Tendenzen am Keyboardmarkt. Und was
mir damals an technischen Begrifflichkeiten entgegen kam,
überstieg all mein minderes Verständnis über
die sich entwickelnde Technologie.
Mitte der 80er war jene Zeit in
der sich die Synthesizerwelt vollkommen zu verändern
schien. In den 70ern war der Aufbau der Synthesizer auf analoger
Basis. Eigentlich wurden die selben Bauteile in den Synthesizer
vom System her verarbeitet und mit wenigen Ausnahmen waren
die Innenteile der Synthesizer vom gleichen Prinzip konstruiert.
Kannte man einen, konnte man ruhigen Gewissens behaupten,
man kenne sich mit der Materie aus. Ich höre sie schon
kommen, jene die mittels erbosten Protestmails und technischen
Korrketuren gegen diese Aussage ptotestieren ;-)
 |
|
Ensoniq
ESQ 1 Logo
|
Nach mehr als einem Jahrzehnt industrieller
Fertigung von Synthesizern begann sich die Synthesizergeschichte
für die Keyboardgemeinschaft radikal zu verändern.
Von da an es ging immer schneller. Bahnbrechend und Vorreiter,
neben den ersten Samplingentwicklungen der frühen 80er,
war 1983 sicherlich ein Keyboard mit der Bezeichnung "DX
7" von Yamaha. Eine neue Syntheseart mittels "Frequenzmodulation"
erzeugte bis dahin ungehörte Klänge. Danach ging
es Schlag auf Schlag und die Konkurrenz reagierte zunehmend
mit zu Hilfenahme neuer digitalen Entwicklungen. "Frequenzmodulation"
gehörte Yamaha. Andere Firmen nutzen zunehmend die Möglichkeit
Wellenformen in digitaler Form abspeichern und in ihre Synthesekonzepte
integrieren zu können.
Genau in jene Zeit fällt auch
die Geschichte unseres nächsten Synthesizers. Dabei handelt
es sich um eine junge Firma die mit ihrem Erstlingswerk Anerkennung
finden konnte. Ensoniq hatte sich bis dahin einen Namen mit
Sampler gemacht. Mirage rollte die Samplinggemeinschaft mit
einem neuen Preiskampf von
unten auf. Der ESQ 1 war das erste Keyboard mit dem sich Ensoniq
in den sich veränderten Synthesizermarkt vorwagte.
Das junge Unternehmen hatte offensichtlich
Spass daran, sich an den Großen zu kratzen. Mit Erheiterung
erinnere ich mich an die Werbeschlacht zwischen Ensoniq und
Roland, als sie um die Vormacht der Zukunft wetteiferten und
das Alter ihrer Zielgruppen zum Werbethema machten. Auf jeden
Fall hatte mich die Werbelinie der jungen Firma vollends überzeugt.
Das spacige und dynamische Bild eines Synthesizers mit der
Überschrift: "Von 0 auf 120 in 3,6 Sekunden…"
Wer wollte das nicht? Ich wusste zwar nicht wohin, aber Hauptsache
schnell. Die technischen Werte der Inserate waren beeindruckend.
Und erst dieses blaue Display... ;-)
Jedenfalls hatte mich die Werbung
wieder mal voll in den Bann gezogen. Dem gegenüber standen
meine ökonomischen Möglichkeiten. In Anbetracht
eines Neupreises über der 30.000 Schilling Grenze bedeutet
dies, wie bei allen Geräten aus dieser Zeit, einfach
mal auf eine Wunschliste verbannen und warten, lange warten…
Wie üblich dauerte es dann
doch einige Jahre, als sich ein Kauf auf den Gebrauchtmarkt
ergab. Es muss so 1994 gewesen sein als ich in Wien ein Exemplar
um 6.500 Schilling ergattern konnte. Von nun an war es auch
mir gegönnt in 3,6 Sekunden auf 120 zu kommen…
.
Der Synthesizer
im Überblick
 |
|
Ensoniq
ESQ 1
|
Ensoniq überraschte bei seiner
Premiere mit einem Gerät, welches an technischen Werten
wahrlich nicht zu geizen wusste. Es handelt sich dabei um
einen subtraktiven achtstimmigen Synthesizer mit einer üblichen
Soundstruktur: Oszillator, Hüllkurven, Filter und Modulationen.
Außergewöhnlich zu dieser Zeit war jedoch die Implementierung
eines internen Sequenzers. Ich kann mich an kein Gerät
aus dieser Zeit erinnern, welches einen Sequenzer in dieser
Qualität an Board integriert hatte. Hätte der ESQ1
noch eine Effektabteilung spendiert bekommen, so könnte
man den ESQ 1 beinahe als erste Workstation bezeichnen. Diese
Ehre hat sich zwei Jahre später der M1 von Korg auf die
Fahnen geschrieben. Zunächst wurde der ESQ 1 als Keyboardvariante
und ein Jahr später als Rackversion unter der Bezeichnung
ESQ1m an den Mann und die Frau gebracht.
Auch bei der Tonerzeugung konnte
Ensoniq mit einigen Überraschungen aufwarten: 3 Oszillatoren
pro Stimme waren damals eine ungewöhnlich großzügige
Ausstattung. 4 Hüllkurven und 3 LFO's ließen jeden
Parameterfreak aufhorchen. Dass obendrauf der Anwender eine
aus 32 digitalisierten Wellenformen für die Oszillatoren
ausgewählt konnte, ließen das Herz jedes Synthesizerfanatikers
höher schlagen.
Alles in allem sprachen die technischen
Werte für sich. Ein Blick auf die Spezifikationen lässt
erkennen, dass sich die Entwickler von Ensoniq mächtig
ins Zeug gelegt hatten. Ensoniq hatte sich viel Mühe
gegeben, sich damit in die Topposition, vorbei an ihren Konkurrenten,
einzureihen. Von 0 in 120 auf die Pole Position. Modulationsquellen
und ein 80 stelliges Display boten bedeutend mehr an technischen
Werten als vergleichbare Konkurrenzprodukte aus der Zeit.
 |
|
Hüllkurvenschema
|
Acht Stimmen waren damals nichts
Außergewöhnliches mehr. Mit 32 gespeicherten Wellenformen
ging der ESQ 1 jedoch in direkte Konkurrenz mit Kawais K3,
der ebenfalls die gleiche Anzahl bot und zeigte, wohin es
gehen sollte. Korgs DW 8000 hingegen hatte nur 16 Wellenformen.
Andere Synthesizer konnten mit den ESQ technisch nur ansatzweise
in Konkurrenz treten, zu gewaltig war die "Parameterflut"
(Ausnahme der Prophet VS mit mehr Wellenformen und Oszillatoren,
der Matrix 6 mit mehr Modulationen u.s.w.). Ob die guten Werte
des ESQ 1 auf dem Papier auch dazu reichten, um soundtechnisch
in die Oberliga einsteigen zu können, wollen wir später
klären.
Verschiedene Firmen versuchten
mittels Erweiterungen am ESQ 1 ökonomisch mitzuknabbern.
So bot unter anderem die Firma PA Decoder verschiedene Cards
bzw. Memory und Wave Expansionen an. Zum einen war daran gedacht
den Speicherinhalt für den Sequencer oder die RAM und
ROM Sounds zu erweitern. Zum anderen sollten zusätzliche
Wellenformen für den ESQ 1 für mehr Pepp und so
für mehr Begehrlichkeit sorgen.
Außen
 |
|
Ensoniq
ESQ 1
|
Der ESQ 1 passt genau in jene Zeit,
aus der er stammt. Kalt, kühl, lässig, einfach formschön.
Das schlichte Schwarz gibt dem Synthesizer einen professionellen
Touch. Das blaue/grüne/türkise (na was denn nun?)
Display mit der typischen Texas Instruments 30 Taschenrechnerschrift
verleiht dem Synth das Gefühl der auferstehenden Computergeneration.
Der Synthesizer ist großteils metallisch, was dem Ganzen
eine gewisse Robustheit verleiht. Meine ESQ 1 haben 2 Studioumzüge
problemlos überstanden. Das macht das Keyboard nicht
gerade zu einem extremen Leichtgewicht. Gewogene 13,5 Kilo
(inkl. Cartridge ;-)) sind jedoch auch für einen Alleinunterhalter
problemlos transportierbar. Gute Bauweise macht sich eben
bemerkbar.
Lassen wir den Blick mal über
die Gehäuseoberfläche schweifen:
Zunächst sind da mal die 61
Tasten - alles klar. Es ist die sinnvolle Aneinanderreihung
der schwarzen und weißen Tasten, dienlich als Interface
für die musikalischen Ergüsse. Die Tatstatur ist
leichtgängig. Nicht die Beste, aber auch nicht die Schlechteste.
Sie entspricht den typischen Plastiktatsturen aus der Zeit
und erfüllt ihre Aufgabe bei mir auch noch nach 20 Jahren.
Mozartpuristen werden aber daran eher wenig Freude finden.
Links davon befinden sich, wie wir es gewohnt sind: Pitchwheel
und Modulationsrad.
Über dem Logo, welches uns
verrät, dass das Gerät eben ESQ 1 benannt wurde,
befindet sich ein Cartridgeschacht. Und zwar noch so ein richtig
globiger seiner Art, wie aus Zeiten des Ataris 2600, wo die
Dinger noch so richtig mit Menpower an ihren vorgesehenen
Platz befördert werden mussten.
Es folgt ein Volumeregler, danach
eine Art Achter-Buttongruppe für das Aufrufen der Soundbänke
bzw. Sequencerbänke. Alle Button sind in schwarz, bis
auf ein Sequenzerbutton, der mit seinem Gelb doch ziemlich
aus der Reihe tanzt. Der nächste Bereich ist für
den Editierbereich vorgesehen. Dieser besteht aus ein Data
Entry Slider und zwei weiße Up- und Downtatster. Compare
und Write Tasten vervollständigen die Editierungssektion.
Das nächste auffällige
Merkmal ist zweifelsohne das 80 zeilige Display in seinem
coolen blau. Es gibt dem Anwender über seine inneren
Werte Bescheid und ist die Kommunikationszentrale. Das Display
wird von 10 Buttons umrandet. Mit diesen kann man entweder
verschiedene Sounds auswählen oder die jeweiligen Funktionen
in den Menüs für das Programmieren aufrufen.
Die strahlend gelbe, quadratische
und nicht zu übersehende 9er Buttongruppe gehört
ausschließlich der Bedienung für die Sequencersektion.
Darüber befinden sich 3 Buttons für Master, Storage
und Edit. Grafisch ein Augenschmaus, ist die nächste
Funktionsgruppe für die Tonerzeugung. Hier hat man versucht,
grafisch mittels eines aufgedruckten Schemas die Tonerzeugung
des ESQ darzustellen. Alle drei Oszillatoren, vier Verstärker
und ein Filter haben je einen eigenen Button zum Aufrufen
der Submenüs.
Darunter die große Gruppe,
die für jeden der LFO's und Hüllkurven ebenfalls
einen eigenen Button anbieten. Master sowie Split/Layer schließen
die Buttonreihe ab. Daneben kann sich noch der Betrachter
an einem aufgedruckten Hüllkurvenmodell über dessen
Aufbau informieren.
Schlicht und einfach, alles da zum Bedienen des Synthesizers
und doch übersichtlich gehalten. So soll es ein.
Rückseite
 |
|
Anschlüsse
des Ensoniq ESQ 1
|
Klar, zunächst gibt es da
einmal den Stereoausgang, der mittels 2 Klinkenstecker das
Audiosignal nach außen führt. Wenn man die Möglichkeit
hat, sollte man den ESQ1 wirklich in Stereo betreiben. Daneben
ein Stecker für ein Fußpedal, mit dem man Modulationen
ansteuern kann. Mittels Tape In und Out kann man seine Speicherverwaltung
über Kasettenrecorder organisieren. Ach, werden da Erinnerungen
in die Datatapes der Brotdose Commodore C64 wahr.
Ein Fußschalter dient zum
Starten und Stoppen des Sequencers und ein weiterer hat die
typischen Sustain Funktion. Bei den Midibuchsen muss ich zwei
mal hinsehen, ob ich mich denn nicht verzählt habe. Tatsächlich
es sind nur zwei! Aber wo ist der dritte? Üblicherweise
lassen die beiden ihren dritten Kumpel doch selten alleine.
Nun Ensoniq dachte sich "hinter uns die Sinnflut"
und haben ganz einfach den Midi Thru Buchse dem Sparwillen
zum Opfer fallen lassen. Keine gute Entscheidung, wie ich
meine.
 |
|
nur
zwei mal Midi
|
Also nur Midi In und Midi out.
Trotzdem schade, denn ich denke eine Midibuchse mehr hätte
den ESQ nicht unwesentlich teurer gemacht, verbannt aber den
Synthesizer an das Ende eine Midikette, sofern man eine hat.
Und bei den logistischen Problemstellungen und Verkabelungsplanungen
eines Midi Setups im Studio, landet der Synth dann vielleicht
an einen Platz, den er nicht verdient hätte.
Die Stromversorgung erfolgt mittels
eines Kaltgerätesteckers, neben dem sich der Powerschalter
und eine Sicherung befinden. Die ganze Leiste für die
Stecker über dem Keyboard ist ein paar Zentimeter nach
innen versetzt. Dem Design tut das gut. Für den Schutz
der Kabel ist diese Art des "Schachtes" auch sicherlich
dienlich. Nur wenn man die Stecker von vorne des Gerätes
anbringen muss, was im Studio meistens der Fall ist, so muss
man Hudini-like seine Handgelenke ganz schön um den Synth
abwinkeln, um in die Öffnungen zu finden oder das Gerät
einfach nur einzuschalten. Nichts, was einen Vorteil hat,
was nicht auch einen Nachteil hat.
Innen
 |
|
Ensoniq
ESQ 1
|
Beim Einschalten meins ESQ 1 begrüßt
er mich mit der Angabe einer Softwareversion und seit mindestens
10 Jahren mit dem netten Hinweis eines notwendigen Batteriewechsels.
Seitdem ist mein Leben voller Panik begleitet, eines Tages
alle Sounds zu verlieren. ;-) Ist wohl wie beim Reservetank
eines Autos. Man kann damit hunderte Kilometer fahren und
wundert sich, warum die Lampe so früh aufleuchtet, bis
man eines Tages am Pannenstreifen der Autobahn steht.
Die Versionsnummer bedeutet scheinbar,
dass es unterschiedliche Versionen geben könnte. Welche
dies sind und ob es überhaupt Unterscheide gibt, kann
ich aus Ermangelung an Kenntnis darüber nicht sagen.
Der Vollständigkeit halber möchte anmerken, dass
sich beide Exemplare von mir mit der Versionsnummer 3,5 melden.
 |
Wie bereits erwähnt,
wartet der ESQ mit einer großen Parameterflut auf.
Wer alle Parameter auf einem Blick (sofern das überhaupt
möglich ist) kann hier mittles eines Klickes eine
eigene Parameterliste
aufrufen. |
Werfen wir hier jedoch einmal
einen Blick auf die einzelnen Funktionsgruppen:
Master
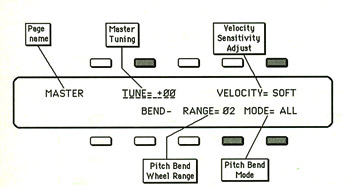 |
|
Masterpage
|
Auf der Masterpage
kann man die Gesamtstimmung des Synthesizers einstellen. Darüber
hinaus kann man die Einstellungen für die Velocity und
das Pitch Bend vornehmen.
Storage
Die Storagepage nimmt alle Einstellungen für die Speicherprozesse
über Audiotape, Midi oder Cartdrige vor.
Midi
Wie der Name schon verrät kann der Anwender auf dieser
Page in die Midibereiche des Gerätes eingreifen. Midikanal,
eine Art Midifilter, Omni/Poly/Multi/Mono, die Einstellung
für einen Controller, das Verknüpfen zweier ESQs
und Midieinstellungen für die Velocity - all das kann
vorgenommen werden.
Mulit Mode war damals noch nicht
Standard und ist bei 8 Stimmen auch nicht wirklich so sinnvoll.
Dennoch bietet der ESQ 1 diesen Mode an. Auch über Mono
Mode kann der Synthesizer betrieben werden. Dieser wird jedoch
kaum Anwendung finden.
Oszillator
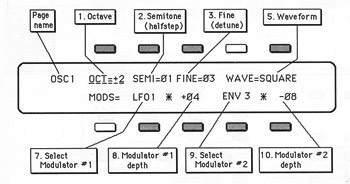 |
|
Oszillator
|
Alle drei Oszillatoren sind gleich
aufgebaut, sodass wir uns auf die Beschreibung eines einzigen
beschränken können. Jeder Oszillator kann mittels
eigenem Button aufgerufen werden, für den sich dann dieselben
Editiermöglichkeiten ergeben.
Zunächst mal ist es möglich,
dem Oszillator eine aus 32 Wellenformen aus dem internen Speicher
zuzuordnen. Dies macht man mit dem Menüpunkt WAVE.
Wellenformen
|
1 SAW
2 BELL
3 SINE
4 SQUARE
5 PULSE
6 NOISE 1
7 NOISE 2
8 NOISE 3
9 BASS
10 PIANO
11 EL PNO
12 VOICE 1
13 VOICE 2
14 KICK
15 REED
16 ORGAN
17 SYNTH 1
18 SYNTH 2
19 SYNTH 3
20 FORMT 1
21 FORMT 2
22 FORMT 3
23 FORMT 4
24 FORMT 5
25 PULSE 2
26 SQR 2
27 4 OCTS
28 PRIME
29 BASS 2
30 E PNO 2
31 OCTAVE
32 OCT +5
|
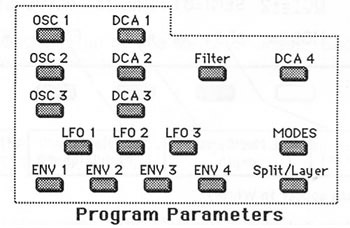 |
|
Soundstruktur
des Ensoniq ESQ 1
|
|
| |
|
Drei Menüpunkte
stehen zur Tonhöheneinstellung zur Verfügung. Mittels
OCT kann man den Oszillator drei Oktaven nach unten oder drei
nach oben transponieren. Mit SEMI kann man in elf Halbtonschritte
verändern und FINE nimmt eine Feinverstimmung in 32 Stufen
vor.
Pro Oszillator gibt es zwei Modulationsstränge.
Hier kann man aus eine von 15 Modulationszielen einstellen
und in der Modulationsstärke von -63 bis + 63 separat
einstellen. Ich habe diese Tonhöhenmodulation wirklich
als besonders reizvoll gefunden. Da kann man schon schräge
Sachen damit machen.
Verstärker
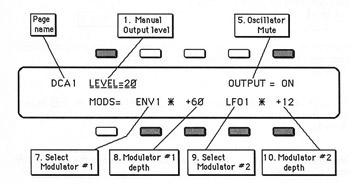 |
|
DCA
Page des Ensoniq ESQ 1
|
Jeder Oszillator hat einen eigenen
Verstärker zugeordnet, der recht flexibel eingestellt
werden kann. Zunächst mal kann in diesem Verstärker
jeder Oszillatoren in seiner Basislautstärke eingestellt
oder auch gemutet werden. Stellt man alle drei Oszillatoren
zu laut ein, kann es zu Verzerrungen kommen. Es sollte demnach
die sich resultierende Gesamtlautstärke im Auge behalten
werden.
Auch die Verstärker können
über zwei Modulationsquellen beeinflusst werden. Hier
kann man sich wieder der 15 Modulationsmöglichkeiten
bedienen. Häufigerweise wird man sich hier jedoch der
Hüllkurvenmodulation annehmen, um die klassische Synthesizerstruktur
und Programmierung der Sounds über die Hüllkurven
vorzunehmen.
 |
|
DCA
Button
|
Diese Art der Programmierung ermöglicht
eine flexible Beeinflussung des Klanges. Man muss sich jedoch
daran gewöhnen, dass die Hüllkurven nicht automatisch
dem Verstärker zugeordnet sind, sondern dass dies der
Anwender selbst vornehmen kann. So kann jedem Oszillator in
Lautstärke eine eigene Hüllkurve zugeordnet werden,
aber man muss eben den "Umweg" über die Modulation
der Verstärker denken. Wer von anderen Synthesizern die
fixe Zuordnung der Hüllkurven gewohnt ist, muss hier
einfach umgewöhnen, aber dafür wird man mit einer
wirklich flexiblen Lautstärkenvariation belohnt.
Filter
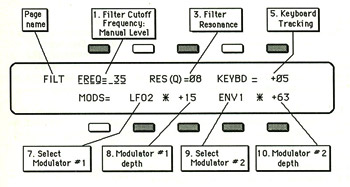 |
|
Filterpage
des Ensoniq ESQ 1
|
Bevor das Signal den Filter erreicht,
wird das Konglomerat aus Oszillatoren und Verstärker
zusammen geführt. Erst dann wird es in die Filtersektion
geleitet. Beim ESQ handelt es sich, laut Bedienungsanleitung,
um einen 4 Pol Tiefbassfilter. Zunächst mal mit den Standardwerten
Cutoffrequenz und Resonanz. Diese beiden "Grundparameter"
geben das Klangbild. Cutoff macht den Klang dumpfer oder heller
und Resonanz hebt die Eckfrequenz. Das kann beim ESQ bis zur
Selbstoszillation reichen - das ist der Bereich, in dem der
Klang zu pfeifen und quietschen beginnt.
 |
|
Display:
Filter
|
Die Cutoff kann in 128 und die
Resonanz in 32 Schritten eingestellt werden. Ein paar Abstufungen
mehr bei der Resonanz wären nicht schlecht gewesen, aber
grundsätzlich kann man die Einstellungen sehr nuanciert
vornehmen. Der Filter ist sicher kein Moogfilter, aber er
macht seine Aufgabe ganz gut, obwohl ich von anderen Geräten
sahnigere seiner Art kenne.
Wie wir es schon von den Oszillatoren
und den Verstärkern kennen, kann man sich hier wieder
zwei Modulationsstränge bedienen. Auch hier dürfte
die Wahl einer Hüllenkurve der Standardfall sein, um
dem klassischen Prinzip eines subtraktiven Synthesizers gerecht
zu werden. Darüber hinaus sind die Modulationsmöglichkeiten
über LFO, Keyboard, Aftertouch, Modulationsräder
und so weiter doch recht flexibel. Beide Modulationsbereiche
können in Intensität separat geregelt werden.
Gesamtlautstärke
und Panorama
 |
|
Ensoniq
ESQ 1
|
Nach dem Filter kann man sich nochmals
eines Verstärkers bedienen. Dieser ermöglicht das
Gesamtsignal in Lautstärke zu beeinflussen. Hierzu ist
diesem Bereich die Hüllkurve 4 fix zugeordnet. Man stellt
aber hier nicht die Hüllkurve selbst ein, sondern nur
wie stark diese wirken soll. Die grundsätzliche Panoramaposition
zwischen links und rechts kann hier in 15 Stufen eingestellt
werden. Darüber hinaus können hier Panoramamodulationen
vorgenommen werden. Man kann aus den Modulationsquellen wieder
aussuchen und in seiner Intensität regeln. Auch diese
Panoramafunktionen werten den ESQ enorm auf. Deshalb sollte
man den Synthesizer auch im Stereobetrieb spielen.
LFO's
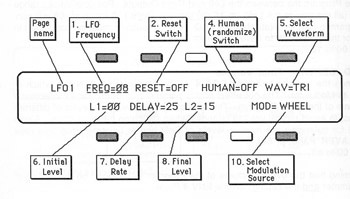 |
|
LFO
Page des Ensoniq ESQ 1
|
Es bedarf nur einen LFO zu erleutern,
da alle drei LFOs sind ident aufgebaut sind. Jeder LFO kann
über ein eigenes Menü aufgerufen werden.
Zunächst kann natürlich
die Wellenform eingestellt werden. Dies kann man mittels der
WAV Taste. Vier Wellenformen bietet der ESQ zur Auswahl: Dreieck,
Sägezahn Rechteck und Noise (Zufallswellenform). Die
Geschwindigkeit wird über FREQ eingestellt, dafür
hat man 64 Stufen. Im unteren Bereich ist der LFO langsam
genug für langatmige Bewegungen, oben rattert es auch
ordentlich schon dahin, obwohl eine Spur schneller auch nicht
schlecht gewesen wäre. Von anderen Geräten kennt
man schneller LFOs. Beim ESQ reicht sie nicht bis zur Selbstoszillation.
Ein Manko, das die meisten "digitalen" Kisten teilen.
Mittels HUMAN Funktion wollte die
Ensoniq Entwickler dem LFO so etwas wie ein unsauberes Timingverhalten
und etwas Menschlichkeit mitgeben. RESET ermöglicht,
den LFO mittels jedem Tastedrucks neu zu starten oder eben
durchlaufen zu lassen. Mittels einer Delayfunktion kann man
den LFO verspäten lassen, so wie wir es von unseren öffentlichen
Verkehrsmitteln gewohnt sind. Darüber hinaus kann die
Modulationstiefe beim Start des LFOs über L1 noch separat
definieren. L2 bestimmt die Modulationstiefe nach erreichen
des Delays. Das ganze kann auf- oder absteigende Wirkung haben,
sodass der LFO auch ausfaden kann - sehr ungewöhnlich.
Wie wir es schon gewohnt sind,
kommt wieder eine der 15 Modulationsquellen ins Spiel. Üblicherweise
wird man das Modulationsrad einstellen, aber man kann auch
einen anderen LFO als Modulationsquelle benutzen, was zu abgefahrenen
Möglichkeiten führt.
Hüllkurven
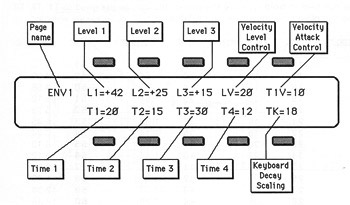 |
|
Envelope
Page des Ensoniq ESQ 1
|
Hüllkurven sind besonders
wichtig für das Klangverhalten eines synthetischen Sounds.
Ohne ihnen wurde stetig ein statischer Sound erklingen, der
recht bald Langeweile aufkommen lassen würde. Sie sind
also elementar wichtig und der ESQ 1 geizt wahrlich nicht
an Angeboten, diese einzusetzen.
Ganze vier Hüllkurven (Envelopes)
bietet der Synthesizer dem Anwender. Die Hüllkurven sind
ident. Versteht man die Funktionsweise einer kann man die
anderen ebenfalls leicht bedienen. Ensoniq geht beim ESQ 1
ein über das bekannte ADSR Prinzip (Attack Decay Sustain
Release) hinaus. Ensoniq hat hierzu vier Level und drei Time
Parameter. Die Werte der 3 Level Parameter können auch
negative sein, also von - 63 bis +63.
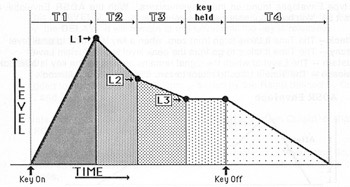 |
|
Envelope
Schema Ensoniq ESQ 1
|
Die Timeparameter haben eine Auflösung
von 0 bis 63, wobei laut Handbuch Null auch 0 Millisekunden
und 63 dann 20,48 Sekunden entspricht. Na ja, ich habe es
nicht gemessen, und bei 0 Millisekunden werde ich ein wenig
skeptisch, aber lassen wir es bei den technischen Werten ;-)
Mit den 3 Levels Parameter bestimmt
man also die Lautstärke an einem bestimmten Zeitpunkt,
mit den 4 Time Parameter herum bestimmt man den Zeitablauf
dazwischen. Das sieht dann im Ablauf etwa so aus:
T1: Einschwingzeit
L1: Lautstärke des ersten Punkt
T2: Zeit von L1 zu L2
L2: Lautstärke des zweiten Punktes
T3: Zeit von L3 zu L3
L3: Lautstärke des dritten Punkt
T4: Zeit zum Ausklingen nach Loslassen der Taste
Im Hüllkurvenmenü gibt
es noch fixe 3 Parameter, die einem die eine separate Modulation
der Hüllkurven quasi ersparen. Es gibt daher keine Modulationsmenüs
für die Hüllkurven.
LV
Hier wird mit der Anschlagdynamik der Tatstur die Lautstärke
von den 3 Punkten T1, T2 und T3 beeinflusst. Dies ermöglicht
durch härteren Anschlag beim Spiel die Hüllkurve
mehr zu öffnen.
T1V
Steht soviel für Velocity Track Control und bedeutet,
dass mittels der Anschlagstärke der Zeitwert T1 (also
die Attack) moduliert wird. Hartes Spiel - schnelle Attack,
weicher Tatsturanschlag - langes Einschwingverhalten.
TK
Hier verändert die Tonhöhe auf der Tastatur das
Zeitverhalten von Time 2 und Time 3.
Modes und Split
/ Layer
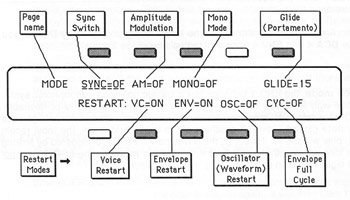 |
|
Mode
Page Ensoniq ESQ 1
|
Mittels der Mode Funktion kann
man grundsätzliche Funktionen wie Oszillatoren Syncronisation
oder Amplituden Modulation zwischen Oszillator 1 und 2 aktivieren.
Eine Mono Funktion in diesem Menü ermöglich einen
einstimmigen Sound. Wer dabei erwatet, dass dabei, wie bei
anderen Synthesizern, der Klang dadurch fetter wird, wird
enttäuscht. Es werden keine Oszillatoren geschichtet
und der Klang ändert sich gar nicht, außer dass
eben nur eine Stimme ertönt. Ziemlich langweilig.
Eine Glide Function in 64 Schritten
ermöglicht das Aktivieren einer Portamentofunktion. Bei
dieser gleitet die Tonhöhe zwischen den angeschlagenen
Tasten. Das kann von einem kurzen Pitch bis hin zu langen
Tonrutsch münden.
 |
|
Mode
bzw Split/Layer Button
|
Voice Restart ist eine Funktion,
die einstellt, wie sich die Stimmenverteilung bei Drücken
derselben Taste im Zusammenhang mit der Release verhält.
Dasselbe gilt auch für eine Art Waveform Restart für
den Wellenformzyklus. Ungewöhnlich, und für mich
bisher nicht ganz nutzbar, ist eine weitere Funktion die sich
CYC nennt. Hier kann man aktivieren, dass die Hüllkurven
auf jeden Fall durchlaufen, unabhängig, wie lange man
die Taste hält.
Man kann den ESQ 1 auch im Split
bzw. im Layer Modus betreiben. Auch für dieses Menü
gibt es einen eigenen Button. Grundsätzlich lässt
sich der Key Splitpunkt frei definieren. Beim Layer wird natürlich
die Stimmenanzahl reduziert, aber das kennen wir ja von anderen
Synthesizern auch.
Modulationen
Wie schon beschrieben kann man
in den einzelnen Menüs die Modulationen, sei es Hüllkurven
oder LFOs, aktivieren. Es gibt daher keinen eigenen Menüpunkt
für die Modulationsmatrix selbst. Dennoch wollen wir
mal einen kurzen Überblick über die 15 Modulationsziele
gewähren.
 |
|
LFO's
|
LFO 1, LFO 2 und LFO 3
Klar, hier werden die 3 LFOs angesteuert, die ja ihrer eigenen
Menüs haben und dort Einstellungen ermöglichen.
ENV 1, ENV 2, ENV 3 und ENV
4
Auch selbsterklärend, dass hier die Hüllkurven gemeint
sind, die ja in den Hüllkurvenmenüs eingestellt
werden.
VEL
Diese Abkürzung steht für Velocity und das bedeutet
soviel wie Anschlagdynamik. Das heißt, drückt der
Spieler wie Hulk in die Tasten, entsteht ein höherer
Wert, der sich je nach Modulationseinstellung (minus oder
plus) auswirkt.
VEL 2
Wirkt genau so wie VEL, nur das die Modulationskurve nicht
linear sondern in einer Kurve verlauft.
KYBD
Dies bedeutet, dass die Tatstatur, also die Höhe der
gespielten Note, Auswirkung auf die Modulation hat. Wobei
Startpunkt der Modulation von 0 weg ist.
KYBD 2
Ebenfalls eine Tastaturmodulation, wobei hier das Spektrum
von minus 63 bis plus 63 verwendet wird.
WHEEL
Hier ist das Modulationsrad, links neben der Tastatur gemeint.
PEDAL
Über ein eigenes CVPedal können ebenfalls Modulationsziele
angesprochen werden.
XTCTRL
Hiermit ist ein externer Midicontroller gemeint. Dazu muss
man auf der Midipage die gewünschte Kontrollernummer
eingeben.
PRESS
Hiermit ist ein Aftertouch gemeint, der ebenfalls über
Midi gesendet werden kann.
Nicht vergessen sollte man, dass
die Modulationen ja nicht nur positive Werte haben können,
sondern auch negative und somit die "Effekte" quasi
umgekehrt werden können.
Sequencer
Gleich mal vorweg. Ich habe den
Sequnecer nie benutzt. Ich kann daher hier leider mit keinem
Erfahrungsbericht aufwarten. Aber ich möchte hier kurz
die Eckdaten des Sequencer beschreiben:
Für die Sequencereinheit sind
9 Funktionsbuttons vorgesehen:
Create/Erase
Edit
Tracks select
Tracks Mx/Midi
Record
Stop/ Cont
Control
Locate
Play
 |
|
Sequencer
Bereich
|
Der Sequencer umfasst 8 Spuren,
die polyphon bespielt werden können. Man beachte jedoch
die 8 Stimmigkeit des Synthesizers. Vielleicht war angedacht,
mittels des Sequencers auch andere Midi Instrumente anzusteuern
und diesen nicht nur intern zu nutzen. 30 Sequencen lassen
sich im Hauptspeicher ablegen. Daraus kann man 10 Songs bilden.
Begrenzt ist das ganze mit 2400 Noten. Eine Erweiterung wurde
jedoch angeboten, welche den Speicher auf 10.000 Noten vergrößert
hat. Die größte Auflösung des Sequenzers beträgt
1/96. Es gibt Quantisierungsmöglichkeiten zwischen ¼
und 1/32 Triolen. Synchronisation via Midi ist möglich.
Ob dieser Sequencer funktionell
oder heute noch von großem Wert ist, kann ich beim besten
Willen nicht beantworten, da ich ihn, wie gesagt, niemals
verwendet habe. Er war aber zu seiner Zeit sicherlich etwas
Besonderes.
Bedienung
 |
|
Ensoniq
ESQ 1
|
Tja, was soll ich sagen? Nun, im
Zuge der Erstellung des Reports war mir alles klar. Die Bedienung
des Synthesizers erscheint mir heute wirklich recht einfach.
Jede Funktionsgruppe hat einen eigenen Button. Aktiviert man
einen der zehn Programmierbutton, die sich rund um das Display
befinden, wird der gewünschte Parameter im Display unterstrichen
und man kann ihn mit dem Slider oder den Up und Down Tasten
verändern. Man hat bei dieser Art der Menüführung
bis zu 10 Parameter gleichzeitig im Überblick, was z.B.
beim Erstellen der Hüllkurven recht hilfreich ist. Geht
ruckizucki.
Bei dieser Beurteilung sollte man
aber nicht die langjährige Erfahrung vergessen. Und jetzt
mal ganz ehrlich, wenn ich an meine Anfangszeiten des ESQ
1 erinnere, so muss ich zugeben, mich mit der Bedienung und
der Art der Menüführung nicht so leicht getan zu
haben, wie es mir beim Erstellen des Workshops erscheint.
Also möchte ich meine heutigen Empfindungen ein wenig
objektivieren. Wenn man keine Erfahrungen mit Synthesizern
hat, muss man sich mit der Menüführung schon mal
beschäftigen um zu verstehen was im inneren des Synthesizers
vorgeht. Aber grundsätzlich und für Erfahrene ist
der Synthesizer auch ohne Bedienungsanleitung zu programmieren.
Man kann während des Programmierens
mittels der Compare Funktion (eigener Taster) immer überprüfen,
wie weit man sich vom Ausgangsklang entfernt hat. Das ist
nett.
 |
|
Ensoniq
ESQ 1
|
Dennoch gibt es einen Wehrmutstropfen:
es sind nicht immer alle 10 Programmiertasten aktiv, d.h.
haben eine Funktion. Bei manchen Seiten sind beispielsweise
dann eben nur sechs, oder drei Buttons aktiv. Da kann es schon
man vorkommen, dass man einfach den falschen und benachbarten
Button anwählt. Es passiert dabei zwar nichts, aber man
hat halt einfach mal umsonst gedrückt und guckt blöd
aus der Wäsche, warum jetzt nichts passiert
Ungewöhnlich ist auch, aber
das ergibt sich aufgrund der flexiblen Programmiermöglichkeiten
des Synthesizers, dass manche Funktionsgruppen wie z.B. die
Hüllkurven nicht fix zugeordnet, sondern eben über
die Modulationswege zugeordnet sind. Man kann sich also nicht
sicher sein, wenn man eine Hüllkurve ändert, wo
denn dies noch Auswirkungen auf den Klang haben kann. Dies
ist keine Kritik, sondern ergibt sich aus der Art der flexiblen
Architektur, so wie sie Ensoniq konstruiert hat.
Speichercard
und Soundverwaltung
 |
 |
|
Cartridge
und Bankauswahl
|
Der ESQ 1 verwaltet seine Sounds
in 10er Bänken, die man mit den Programmtasten rund ums
Display aufrufen kann. Den Klängen kann dabei ein Namen
vergeben werden, was das Auffinden der Klänge erleichtert.
Auf insgesamt vier dieser Bänke kann man im internen
RAM zugreifen. Also stehen zunächst 40 Klänge direkt
zur Auswahl.
Ist man glücklicher Besitzer
einer Cartridge, so erweitert sich der direkte Zugriff auf
120 Sounds.Denn
auf einer solchen Cartridge befinden sich zwei Masterbänke
mit jeweils vier Bänke à 10 Sounds, macht summasumarum
80 Sounds auf der Cartridge. Will man von einem Sounds auf
den anderen wechseln, kann es schon vorkommen, dass man drei
Buttons drücken muss. Zuerst die Master Bank (Cart A,
Cart B oder Internal), dann eine der vier Bänke und zu
guter letzt den Programmerbutton selbst.
Sound
 |
|
Ensoniq
ESQ 1
|
Wie klingt er nun - vermutlich
die wichtigste Frage in Bezugnahme auf ein Musikinstrument.
Zuerst einmal die schlechte Nachricht: wer augrund der Parameterflut
und der Editiermöglichkeiten einen richtig warmen Analogsynth
unter den Fingen zu haben glaubt, der irrt gewaltig. Der ESQ
ist alles anderes als eine Konkurrenz für die Oberheims
oder Rolands der frühen 80er. Die Frage ist, ob er es
sein soll?
Nun, geht man von den Entwicklern
des Ensoniq aus, die dem ESQ so etwas wie synthetische Bezeichnungen
wie Saw, Square, Pulse oder auch andere additive Synthwaveformes
bei den Wellenformen mitgegeben haben, so war dies vermutlich
durchaus Absicht. Ich denke der ESQ sollte warm klingen, aber
bei der ganzen Parameterflut konnten die Computerentwickler
dann doch in die Geheimnise der traditionellen Bauweise eines
Synthesizers eindringen. Der ESQ ist wohl neben dem PPG einer
der ersten Synth, der tatsächlich in Richtung Computerklang
tendiert.
 |
|
ESQ 1 Logo
|
Lassen wir nun diese Tatsache mal
beiseite und betrachten den Synthesizer als das, was er ist.
Und dann ergibt sich ein ganz anderes Bild. Der ESQ ist wirklich
unglaublich flexibel. Über die Werte brauche ich nicht
näher eingehen, die haben wir ausführlich beleuchtet.
Fast schon selbstverständlich sollte sein, dass digitalisierte
Wellenformen aus der Zeit nicht den Anspruch auf Authenzität
eines Samplers haben. Sieht man sich die Wellenformenbezeichnungen
an, wird offensichtlich, dass dies auch nicht Absicht war.
Der ESQ ist definitiv ein Synthesizer.
Und da macht er seine Aufgabe gut.
Wer sich die Audiobeispiele des ESQ 1 anhört, wird glockenartiges
mit viel Nuancen und Details zu hören bekommen, schneidige
Leadsounds der anderen Art, blubbernde Sounds mit Pitchmodulationen,
digitale Flächen - der ESQ macht einfach Spass. Synthchöre,
PPG Sounds, Sequencerpeaks - alles kein Problem für den
Synthesizer, bei dem er die Konkurrenz aus dieser Zeit (mit
Ausnahme des Prophet VS) weit hinter sich läßt.
Der Grundcharakter des Instrumentes bleibt jedoch kalt, fast
wie es sein Erscheinungsbild selbst ankündigt, und das
meine ich jetzt im besten Sinne. Meine Erfahrung in der Einbindung
des ESQ 1 in Arrangements sind gute. Der Synth integriert
sich angenehm im Zusammenspiel mit anderen.
Erstellen wir einmal eine subjektive
analog versus digital Liste, von den bisher hier veröffentlichten
Reports über Synthesizer der annähernd gleichen
Ära und Preisklasse, um zu Veranschaulichen, wo der ESQ
in diesem Spektrum steht. Der Fokus liegt auf "wie digital
kann ein Synth klingen?".
Roland JX8P - Oberheimi
Matrix 6 - Korg DW 6000 - Kawai K3 - Ensoniq ESQ 1 - Prophet
VS
 |
|
Ensoniq
ESQ 1
|
Wobei der Prophet VS eine Ausnahmestellung
einnimmt, weil er ebenfalls im Gewässer der analogen
Soundwelt fischen kann. Mir ging es hier um wie digital kann
ein Synth klingen.
Ich habe den ESQ wirklich zu schätzen
gelernt und ihn ab der Panorama Produktion in fast allen CDs
eingesetzt. Wieder verstärkt kam der Synthesizer auch
in der "Danger in dream" Produktion zum Einsatz,
wo er all seine Vorzüge ausspielen durfte. Leider sind
mir kaum andere Musiker bekannt, die den ESQ eingesetzt haben,
um damit andere Referenzen nennen zu können.
 |
|
Robert
Wittek
|
Wer also ein Gerät zum Soundtüfteln
sucht, der ist mit dem ESQ gut dran. Ich würde ihn jedoch
nicht einzig und allein als Hauptsynth verwenden, dazu ist
er zu charakteristisch und kalt, aber im Zusammenspiel mit
einem analogen Partner spielt er sein wahren Stärken
aus. Ensoniq ist mit seinem "Erstlingswerk" ein
einfach schöner Synthesizer gelungen.
Autor: Robert Wittek
Jänner 20007
Wie immer Danke für das Redigieren
an Cornelia Wittek
Audio
Workshop Ensoniq ESQ 1 zum Downloaden
Mit
mehr als 50 verschiedene Klangbeispielen!
Download
Audifile MP3 9,61MB Länge: 14,58 min
Die Audiofiles
haben aufgrund der Datenkomprimierung leichte Klangeinbußen.
Die Verringerung der Klangqualität dient Ihnen zur kürzeren
Downloadzeit. Alle Soundbeispiele wurden ausschließlich
mit den ESQ 1 erzeugt. Delay und Reverb kamen ebenfalls zum
Einsatz.
Manual und Links
|

